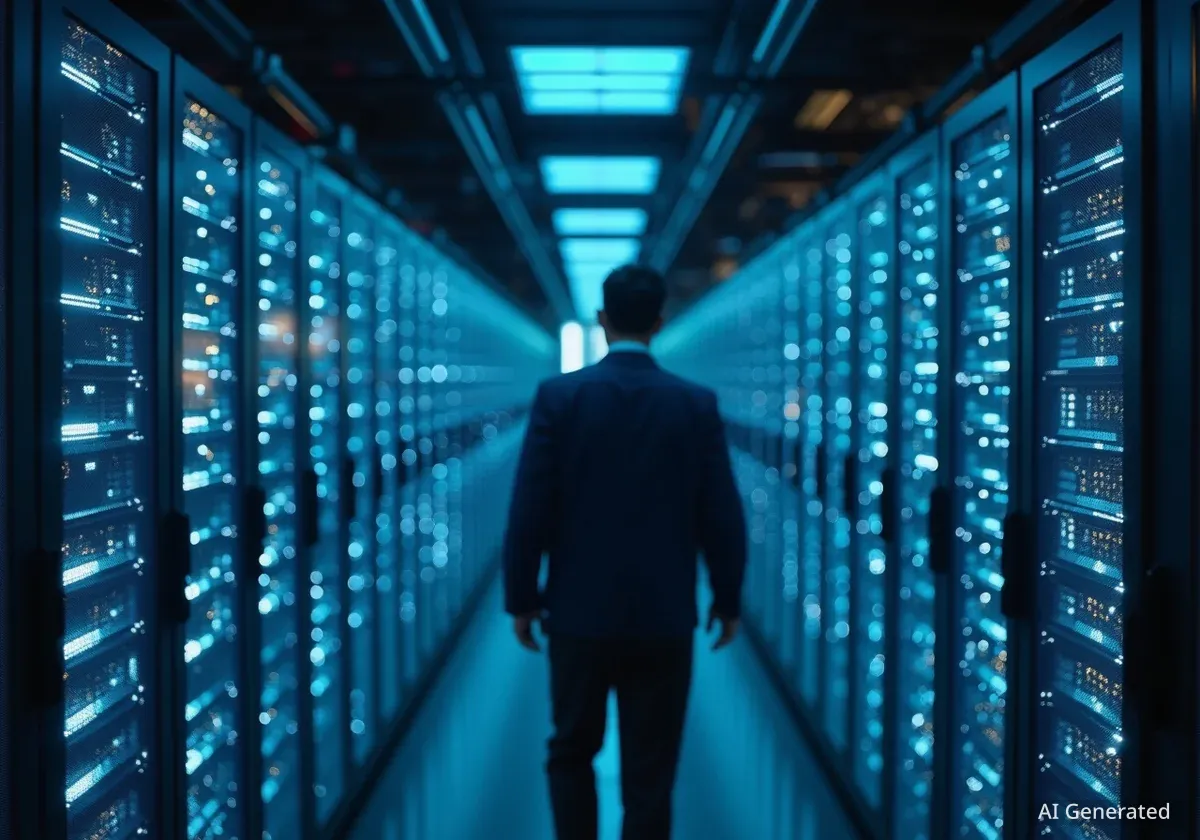Der digitale Euro ist ein zentrales Projekt für die Stärkung der europäischen Unabhängigkeit im Zahlungsverkehr. Er soll Europas strategische Autonomie festigen und die Abhängigkeit von externen Anbietern reduzieren. Dies betonte Burkhard Balz, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank, auf dem Global FinTech Fest in Mumbai. Die Einführung eines digitalen Euros wird als notwendiger Schritt gesehen, um Europas Position in einer zunehmend unsicheren geopolitischen Landschaft zu sichern.
Wichtige Punkte
- Der digitale Euro soll Europas digitale Souveränität im Zahlungsverkehr sichern.
- Aktuell dominieren nicht-europäische Anbieter den Zahlungsverkehr in der Eurozone.
- Der digitale Euro wird auf europäischer Infrastruktur basieren und die Autonomie stärken.
- Er bietet Bürgern mehr Datenschutz und eine europaweite, einheitliche Zahlungsmethode.
- Die Einführung wird nicht vor 2028 erwartet, da Gesetzgebungsprozesse noch laufen.
Europas Abhängigkeit im digitalen Zahlungsverkehr
Die digitale Landschaft ist stark von wenigen großen Technologieunternehmen geprägt, die hauptsächlich aus den USA stammen. Dies gilt für E-Commerce, soziale Medien und auch für den digitalen Einzelhandel. Im Euroraum wickeln nicht-europäische Anbieter wie Visa, Mastercard und PayPal einen Großteil der Kartenzahlungen ab.
Fast zwei Drittel aller Kartenzahlungen im Euroraum werden von diesen meist US-amerikanischen Unternehmen verarbeitet. Nur 35 Prozent der Euro-Länder verfügen über eine eigene, unabhängige Zahlungslösung. Deutschland nutzt beispielsweise die Girocard, doch diese ist oft auf nationale Anwendungen beschränkt. Für grenzüberschreitende Zahlungen innerhalb der Eurozone ist die Infrastruktur internationaler Anbieter erforderlich.
Faktencheck
- 65% der Kartenzahlungen in der Eurozone werden von nicht-europäischen Anbietern abgewickelt.
- 35% der Euro-Länder haben eine eigene nationale Zahlungslösung.
- PayPal hat in Deutschland einen Marktanteil von fast 30% bei Online-Zahlungen.
Herausforderungen durch Stablecoins und geopolitische Risiken
Die Beliebtheit dieser Systeme ist nachvollziehbar, da sie bequem und zuverlässig sind. Doch Zahlungssysteme sind eine kritische Infrastruktur. Eine Störung könnte weitreichende finanzielle und wirtschaftliche Folgen haben. Zudem entscheiden internationale Kartensysteme über Gebühren und erhalten Einblicke in wirtschaftliche und persönliche Beziehungen, was Bedenken hinsichtlich der Datensouveränität aufwirft.
Neue Entwicklungen, insbesondere die Zunahme von Stablecoins, könnten die Abhängigkeit weiter verstärken. Die US-Regierung fördert die Ausgabe von privat emittierten Stablecoins, die an den US-Dollar gekoppelt sind. Eine weite Verbreitung solcher Stablecoins könnte die Souveränität Europas im Zahlungsverkehr gefährden.
„Für Europa hat sich die Notwendigkeit bekräftigt, unsere strategische Unabhängigkeit ohne Zögern zu stärken. Der digitale Euro ist ein Eckpfeiler europäischer digitaler Souveränität.“
Burkhard Balz, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank
Hintergrund: Globale Herausforderungen
Die G20-Staaten haben schnellere, günstigere, transparentere und inklusivere grenzüberschreitende Zahlungen zu einer globalen Priorität erklärt. Länder wie Indien zeigen mit Initiativen wie dem Unified Payments Interface, wie Innovationen in diesem Bereich wirken können. Die Debatte über digitales Geld und Zahlungen ist daher nicht nur eine europäische, sondern eine globale Angelegenheit.
Der digitale Euro als strategische Antwort
Der digitale Euro soll Autonomie, Effizienz und Resilienz des europäischen Zahlungsverkehrs verbessern. Er ist als europäische Antwort auf die aktuellen Herausforderungen konzipiert.
Stärkung der Autonomie
Europa kann es sich nicht leisten, bei kritischer Infrastruktur wie dem Zahlungsverkehr stark von ausländischen Anbietern abhängig zu sein. Der digitale Euro würde vollständig auf europäischer Infrastruktur betrieben werden. Dies würde ein hohes Maß an operativer Unabhängigkeit gewährleisten.
Zudem würde der digitale Euro die Autonomie jedes einzelnen Bürgers stärken. Er ist als digitales Äquivalent zu Bargeld konzipiert. Er wäre staatlich garantiert, immer verfügbar und böte einen höheren Grad an Privatsphäre als andere digitale Zahlungsmethoden. Er wäre europaweit einsetzbar, sei es im Geschäft, beim Online-Shopping oder bei Geldtransfers an Freunde. Der digitale Euro soll Zahlungen einfach, sicher und dateneffizient gestalten.
Offline-Zahlungen wären in begrenztem Umfang möglich. Dies gewährleistet die Funktionalität auch bei Internet- oder Stromausfällen. Der digitale Euro bietet den Europäern die Freiheit, die digitale Zahlungsmethode zu wählen, die sie bevorzugen.
Einheitlicher Zahlungsraum und Effizienz
Der digitale Euro würde einen einheitlichen Zahlungsraum innerhalb der Eurozone schaffen. Einheitliche europäische Standards würden ein starkes und zukunftssicheres Zahlungssystem garantieren. Dies würde grenzüberschreitende Transaktionen vereinfachen. Gleiche Standards, gleiches System, gleiche 'Zahlungsschienen' in ganz Europa.
Dies würde die Effizienz innerhalb des Euroraums erheblich steigern. Zukünftig könnte der digitale Euro auch im Ausland verwendet werden, obwohl dies kurzfristig nicht das Hauptziel ist.
Resilienz gegen konkurrierende Währungen
Drittens würde der digitale Euro die Widerstandsfähigkeit der Euro-Länder gegenüber konkurrierenden Währungen und Stablecoins stärken. Er bewahrt die Ankerfunktion des Zentralbankgeldes. Im Gegensatz zu Stablecoins, die Liquiditäts- und Kreditrisiken unterliegen, bietet der digitale Euro eine sichere und zuverlässige Alternative. Stablecoins, insbesondere solche, die an den US-Dollar gekoppelt und nicht in Europa reguliert sind, sind aus europäischer Sicht kein praktikabler Ersatz.
- Autonomie: Betrieb auf europäischer Infrastruktur, weniger Abhängigkeit.
- Datenschutz: Höherer Schutz als bei anderen digitalen Methoden.
- Verfügbarkeit: Immer verfügbar, auch offline (begrenzt).
- Einheitlichkeit: Gleiche Standards für grenzüberschreitende Zahlungen.
- Sicherheit: Zentralbankgeld als sichere Alternative zu Stablecoins.
Zeitplan und Ausblick
Die Einführung des digitalen Euros ist ein ehrgeiziges Projekt, das Zeit benötigt. Die Deutsche Bundesbank rechnet mit einer schrittweisen Einführung nicht vor dem Jahr 2028. Dies liegt auch an dem noch laufenden Gesetzgebungsprozess durch die europäischen Gesetzgeber.
Burkhard Balz zitierte den amerikanischen Baseballspieler Hank Aaron: „Beim Ballspielen und im Leben bekommt man gelegentlich die Gelegenheit, etwas Großartiges zu tun. Wenn diese Zeit kommt, zählen nur zwei Dinge: darauf vorbereitet zu sein, den Moment zu nutzen, und den Mut zu haben, seinen besten Schlag zu tun.“
Das Eurosystem ist nach seinen Worten bereit, die Effizienz, Widerstandsfähigkeit und Autonomie des europäischen Einzelhandelszahlungsverkehrs zu verbessern. Mit der Unterstützung mutiger Gesetzgeber ist Balz zuversichtlich, dass Europa diesen Schritt erfolgreich meistern wird.